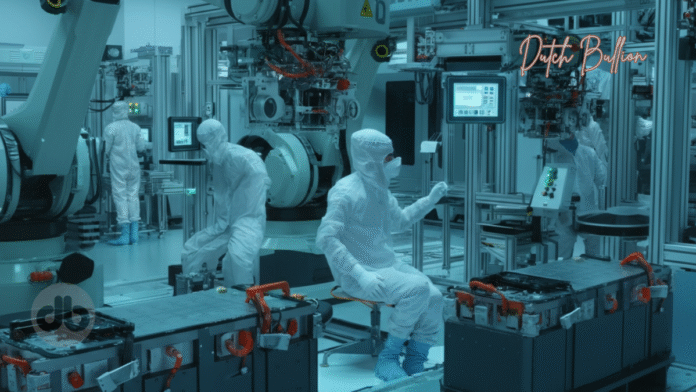Es war ein Paukenschlag, der durch die deutsche Automobilindustrie hallte und weit darüber hinaus zu spüren war: Porsche, die Ikone deutscher Ingenieurskunst und Inbegriff des Sportwagens, zieht bei seinem Prestigeprojekt Cellforce den Stecker. Die ambitionierte Vision, in Deutschland eine hochmoderne Batteriezellfertigung aufzubauen und die Elektromobilität mit „Made in Germany“-Qualität zu prägen, ist vorerst gescheitert. Was auf dem Papier wie ein logischer und zukunftsweisender Schritt aussah – ein Joint Venture zwischen Porsche und dem Batteriespezialisten Customcells – endet nun in einem Meer aus Enttäuschung, Ungewissheit und der bitteren Entlassung von Hunderten hochqualifizierten Mitarbeitern.
Diese Entscheidung ist weit mehr als nur eine betriebswirtschaftliche Korrektur eines einzelnen Unternehmens. Sie ist ein alarmierendes Symptom für die tiefgreifenden Probleme, mit denen die deutsche und europäische Automobilindustrie bei der Transformation zur Elektromobilität konfrontiert ist. Der Fall Cellforce legt die schonungslose Realität offen: Zwischen politischem Wunschdenken, technologischem Anspruch und den brutalen Gesetzen des globalen Marktes klafft eine gewaltige Lücke. Es ist die Geschichte eines Traums, der an der harten Wirklichkeit zerschellt ist – und sie zwingt uns, unbequeme Fragen zu stellen: Haben wir uns übernommen? Sind wir im globalen Wettlauf um die Schlüsseltechnologie der Zukunft bereits hoffnungslos im Hintertreffen? Und was bedeutet das abrupte Ende der Porsche-Batterieproduktion für den Standort Deutschland?
Ich meine, dies ist kein isoliertes Ereignis, sondern ein Weckruf. Es ist ein Moment, in dem wir innehalten und analysieren müssen, warum ein so starkes Unternehmen wie Porsche einen solchen Rückzieher macht. Es geht nicht nur um verlorene Arbeitsplätze und verschwendete Steuermillionen; es geht um die Zukunftsfähigkeit unserer wichtigsten Industrie.
Cellforce: Aufstieg und Fall eines Hoffnungsträgers
Um das ganze Ausmaß dieser Entscheidung zu verstehen, müssen wir uns die ursprüngliche Vision von Cellforce in Erinnerung rufen. Im Jahr 2021 wurde das Unternehmen mit großen Fanfaren gegründet. Porsche wollte nicht einfach nur Batteriezellen von asiatischen Giganten wie CATL oder LG Chem zukaufen. Der Anspruch war weitaus größer: Man wollte die Kontrolle über die Kernkomponente des Elektroautos – die Batterie – zurückgewinnen.
Die Vision: Technologieführerschaft „Made in Germany“
Die Idee war brillant und strategisch klug. Cellforce sollte sich auf die Entwicklung und Produktion von Hochleistungs-Batteriezellen spezialisieren. Diese Zellen waren nicht für die Massenproduktion im VW Golf gedacht, sondern für die Spitze der Pyramide: für die Hochleistungs-Sportwagen und limitierten Sonderserien von Porsche. Man sprach von Silizium-Anoden, die eine höhere Energiedichte und deutlich schnellere Ladezeiten ermöglichen sollten. Das Ziel war, einen technologischen Vorsprung zu erzielen, der die Marke Porsche auch im Elektrozeitalter an der Spitze positionieren würde.
Der Standort in Kirchentellinsfurt, nahe Tübingen und Reutlingen, sollte als „Anlauffabrik“ dienen. Hier wollte man in kleinerem Maßstab die Prozesse perfektionieren, um sie später hochzuskalieren. Für die Mitarbeiter, wie den im ursprünglichen Bericht zitierten Logistiker Sebastian Rohloff oder den Informatiker Dominik Rein, war Cellforce mehr als nur ein Job. Es war die Chance, an einer Revolution mitzuwirken, an einem zukunftssicheren Arbeitsplatz in einer der wichtigsten Industrien des 21. Jahrhunderts. Sie gaben „Vollgas“, wie es einer von ihnen ausdrückte, im Glauben an eine strahlende Zukunft.
Die staatliche Förderung: Ein teures Versprechen
Dieser Optimismus wurde von der Politik kräftig befeuert. Das Projekt Cellforce wurde als leuchtendes Beispiel für die Reindustrialisierung Deutschlands im Bereich der Batterietechnologie gefeiert. Entsprechend großzügig flossen die Subventionen. Rund 56,7 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln wurden für das Projekt zugesagt, wovon allein Baden-Württemberg bisher etwa 14 Millionen Euro beigesteuert hat.
Diese Steuermillionen waren nicht nur eine Finanzspritze, sondern auch ein politisches Statement. Sie sollten signalisieren: Deutschland meint es ernst mit der Batteriezellenfertigung. Wir schaffen die Rahmenbedingungen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen und unsere „industrielle Souveränität“ zu sichern. Das Vertrauen in die Strahlkraft von Porsche und die technologische Expertise war immens.
Die brutale Realität: Warum der Traum platzte
Doch nur vier Jahre später ist die Ernüchterung grenzenlos. Porsche stampft die Produktionspläne ein. Der Fokus soll nun allein auf der Zell- und Systementwicklung liegen – die eigentliche Fertigung wird aufgegeben. Als Begründung nennt Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner eine weltweit schwächere Marktentwicklung für Elektrofahrzeuge als ursprünglich angenommen. Das geplante Geschäftsmodell sei „wirtschaftlich nicht darstellbar“.
Diese Erklärung ist meiner Meinung nach nur die halbe Wahrheit und kratzt lediglich an der Oberfläche eines vielschichtigen Problems.
| Faktor | Beschreibung | Auswirkung auf Cellforce |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Die Nachfrage nach E-Autos, besonders in China und den USA, entwickelt sich langsamer und unvorhersehbarer als prognostiziert. | Die Absatzprognosen für Hochleistungs-E-Modelle von Porsche wurden unsicher, was die Kalkulation für eine eigene Zellproduktion erschwerte. |
| Globaler Preisdruck | Massive Überkapazitäten und staatliche Subventionen in China führen zu einem Preisverfall bei Batteriezellen. | Cellforce hätte niemals zu Preisen produzieren können, die mit den subventionierten Billigakkus aus China konkurrieren können. Die Kostenstruktur in Deutschland ist zu hoch. |
| Hohe Energiekosten | Deutschland hat im internationalen Vergleich extrem hohe Strompreise, ein entscheidender Nachteil für die energieintensive Batteriezellenproduktion. | Die Betriebskosten für die geplante Fabrik wären von Anfang an nicht wettbewerbsfähig gewesen. |
| Bürokratie & Fachkräftemangel | Langwierige Genehmigungsverfahren und der Mangel an spezialisierten Fachkräften bremsen den Aufbau neuer Industrieanlagen in Deutschland. | Verzögerungen und höhere Kosten beim Aufbau der Produktion wären wahrscheinlich gewesen, was die wirtschaftliche Tragfähigkeit weiter untergraben hätte. |
| Technologischer Wandel | Die Batterietechnologie entwickelt sich rasant. Eine heute geplante Fabrik kann morgen schon wieder veraltet sein (z.B. durch Fortschritte bei Feststoffbatterien). | Das Risiko einer milliardenschweren Fehlinvestition in eine Technologie, die schnell überholt sein könnte, war für Porsche zu hoch. |
Die Entscheidung von Porsche ist also weniger ein Zeichen für eine grundsätzliche Abkehr von der Elektromobilität, sondern vielmehr eine knallharte kaufmännische Kapitulation vor den globalen Realitäten. Es ist das Eingeständnis, dass der Aufbau einer eigenen, wettbewerbsfähigen Batteriezellenfertigung in Deutschland unter den aktuellen Bedingungen ein zu großes Wagnis ist – selbst für einen profitablen Giganten wie Porsche.
Die größeren Zusammenhänge: Cellforce ist kein Einzelfall
Wer glaubt, das Scheitern von Cellforce sei ein spezifisches Porsche-Problem, irrt gewaltig. Es ist ein weiteres Puzzleteil in einem beunruhigenden Gesamtbild. Erinnern wir uns an die kürzliche Insolvenz des schwedischen Batterieherstellers Northvolt, der ebenfalls mit massiver staatlicher Förderung eine große Fabrik in Schleswig-Holstein plante. Oder blicken wir auf Opel, das seine Strategie, ab 2028 nur noch E-Autos zu bauen, einkassiert hat.
Diese Ereignisse zeigen: Die europäische Industrie gerät im globalen Batteriekrieg massiv unter Druck.
Der chinesische Drache: Dominanz durch Subventionen
Der Hauptgrund für diese Misere hat einen Namen: China. Das Reich der Mitte hat mit einer beispiellosen und langfristig angelegten Industriestrategie eine marktbeherrschende Stellung bei der Batterieproduktion erlangt. Mit enormen staatlichen Subventionen wurden gigantische Produktionskapazitäten aufgebaut. Das Ergebnis ist eine Überproduktion an Billigakkus, die nun den Weltmarkt fluten.
Wie der Experte Helmut Ehrenberg vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) treffend feststellt, führt dies zu einem „verzerrten Preisniveau“. Europäische Hersteller können unter diesen Bedingungen schlichtweg nicht kostendeckend produzieren. Es ist ein unfairer Wettbewerb, bei dem ein freier Markt gegen eine staatlich gelenkte Planwirtschaft antritt.
Der amerikanische Magnet: Der „Inflation Reduction Act“
Während Europa mit hohen Energiepreisen, Bürokratie und einem unfairen Wettbewerb aus China kämpft, haben die USA eine andere Strategie gewählt. Mit dem „Inflation Reduction Act“ (IRA) lockt die US-Regierung Unternehmen mit massiven Subventionen und Steuererleichterungen an, ihre Produktionsstätten in den USA aufzubauen.
Für international agierende Konzerne wird es damit, wie Ehrenberg es formuliert, „leicht gemacht, eher eine Produktionsstätte in den USA als in Europa einzurichten. Das Kapital fließt dorthin, wo die Bedingungen am besten sind – und das ist derzeit oft nicht Deutschland oder Europa. Wir befinden uns in einem Zangengriff zwischen chinesischer Dumping-Konkurrenz und amerikanischer Subventionspolitik.
Was bedeutet das für Porsche und die deutsche Autoindustrie?
Die Entscheidung von Porsche ist schmerzhaft, aber aus unternehmerischer Sicht vielleicht sogar rational. Anstatt Milliarden in eine eigene, unwirtschaftliche Fertigung zu stecken, konzentriert man sich nun auf die Entwicklung – das „Gehirn“ der Batterie. Die Zellen selbst wird man wohl weiterhin von spezialisierten Partnern aus Asien beziehen.
Kurzfristig mag das die Bilanzen von Porsche schonen. Man vermeidet ein finanzielles Desaster und kann flexibler auf technologische Sprünge reagieren.
Langfristig ist diese Strategie jedoch hochriskant.
- Abhängigkeit: Die deutsche Automobilindustrie begibt sich in eine noch größere Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern. Preisschwankungen, Lieferengpässe oder geopolitische Spannungen können die gesamte Produktion lahmlegen. Die „industrielle Souveränität“, die die Politik so gerne beschwört, rückt in weite Ferne.
- Know-how-Verlust: Die Trennung von Entwicklung und Produktion ist gefährlich. Wichtiges Prozess-Know-how, das nur in der Massenfertigung entsteht, geht verloren. Die Entwickler entwerfen dann Batterien, ohne die Tücken der Produktion im Detail zu kennen. Dieser Verlust an Fertigungskompetenz ist kaum wieder aufzuholen.
- Innovationsbremse: Echte Sprunginnovationen entstehen oft an der Schnittstelle von Forschung, Entwicklung und Produktion. Wenn die Produktion ausgelagert wird, verringert sich die Chance, durch einen integrierten Ansatz bahnbrechende neue Batterietechnologien zu entwickeln und schnell zur Marktreife zu bringen.
Für die gesamte deutsche Autoindustrie ist der Fall Cellforce ein Menetekel. Er zeigt, dass selbst die finanzstärksten und technologisch führenden Unternehmen davor zurückschrecken, den Kampf um die Batteriezellenproduktion in Europa aufzunehmen. Wenn schon Porsche scheitert, wer soll es dann schaffen?
Ein Weckruf an die Politik: Es braucht mehr als nur Subventionen
Die Reaktion aus dem Bundeswirtschaftsministerium auf das Cellforce-Aus wirkt fast schon hilflos. Man verweist auf das Ziel, die Batteriezellenfertigung stärken zu wollen, kann aber zu konkreten Fällen nichts sagen. Das reicht nicht!
Es ist an der Zeit, die deutsche und europäische Industriepolitik radikal neu zu denken. Einfach nur Geld über ambitionierte Projekte zu streuen, in der Hoffnung, dass es schon gut gehen wird, ist offensichtlich gescheitert. Was wir brauchen, ist ein umfassendes strategisches Paket:
- Wettbewerbsfähige Energiepreise: Die energieintensive Batterieproduktion braucht international wettbewerbsfähige Strompreise. Ein Industriestrompreis oder ähnliche Modelle müssen dringend auf den Tisch.
- Abbau von Bürokratie: Genehmigungsverfahren für neue Fabriken müssen drastisch beschleunigt werden. Wir können es uns nicht leisten, Jahre zu verlieren, während anderswo auf der Welt Fakten geschaffen werden.
- Fokus auf Recycling und Kreislaufwirtschaft: Hier liegt eine riesige Chance für Europa. Wie Professor Ehrenberg betont, können wir durch ein konsequentes Recycling von Batterien langfristig unsere Abhängigkeit von Rohstoffimporten aus China und anderen Regionen reduzieren. Wir müssen eine geschlossene Wertschöpfungskette in Europa aufbauen – vom Recycling der alten Batterie bis zur Produktion der neuen.
- Klare handelspolitische Kante: Gegenüber dem unfairen Wettbewerb aus China braucht es eine klare und robuste europäische Handelspolitik. Das kann von Schutzzöllen bis hin zu strengeren Nachhaltigkeits- und Sozialstandards für importierte Batterien reichen.
Mein Fazit und Ausblick: Der Traum ist nicht ausgeträumt, aber er braucht ein neues Drehbuch
Das Ende der Porsche Cellforce-Produktion ist eine bittere Pille und ein schwerer Rückschlag. Aber es ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist ein Moment der schmerzhaften, aber notwendigen Wahrheit. Wir müssen erkennen, dass der Traum von einer flächendeckenden, wettbewerbsfähigen Batteriezellenproduktion in Deutschland unter den aktuellen globalen und nationalen Rahmenbedingungen eine Illusion war.
Porsche hat eine unternehmerische Entscheidung getroffen, die man kritisieren kann, die aber nachvollziehbar ist. Die Konzentration auf die Entwicklung ist ein Versuch, zumindest die technologische Kompetenz im eigenen Haus zu halten.
Für Deutschland und Europa bedeutet dies, dass wir unsere Strategie anpassen müssen. Wir werden kurz- und mittelfristig nicht in der Lage sein, China bei der Massenproduktion von Standard-Batteriezellen preislich zu unterbieten. Das ist eine Realität, die wir akzeptieren müssen.
Unsere Chance liegt woanders:
- In der Nische: Spezialisierung auf Hochleistungszellen für Premium-Anwendungen, wie es Cellforce ursprünglich vorhatte – aber vielleicht in einem europäischeren Verbund und mit einer realistischeren Kostenstruktur.
- In der nächsten Generation: Wir müssen massiv in die Forschung und Entwicklung von Zukunftstechnologien wie Feststoffbatterien investieren, um bei der nächsten Technologiewelle an der Spitze zu stehen.
- In der Kreislaufwirtschaft: Der Aufbau einer führenden Recycling-Industrie kann uns eine strategische Autonomie bei den Rohstoffen sichern, die Gold wert sein wird.
Der Fall Cellforce ist kein Ende, sondern eine Zäsur. Er markiert das Ende naiver Träume und den Beginn einer hoffentlich realistischeren und strategisch klügeren Industriepolitik. Der Weg zur Elektromobilität ist unumkehrbar, aber der Pfad dorthin ist steinig und voller globaler Herausforderungen. Es liegt an uns – an der Industrie und vor allem an der Politik –, die richtigen Lehren aus diesem Debakel zu ziehen und ein neues, tragfähiges Drehbuch für die Zukunft unserer wichtigsten Industrie zu schreiben. Die Zeit der schönen Reden und großzügigen Schecks ist vorbei. Jetzt sind harte, strategische Entscheidungen gefragt.